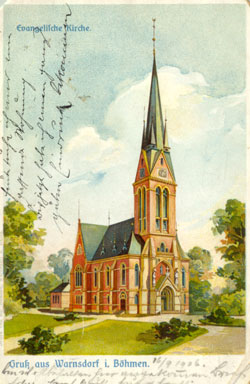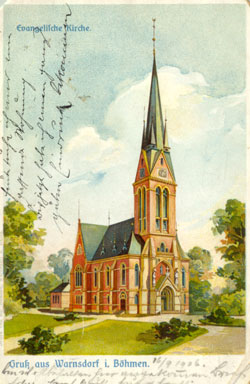 Evangelický kostel,
Evangelický kostel,
pohlednice z roku 1906Varnsdorf ist die Stadt mit der zweithöchsten Einwohnerzahl im Kreis Děčín (Tetschen). Seinerzeit handelte es sich um das größte Dorf der Habsburger Monarchie. Am 28. Juli 1868 wurde Varnsdorf zur Stadt ernannt. Anfang des darauffolgenden Jahres wurde die Zugstrecke zwischen Varnsdorf und Podmokly (Bodenbach) über Rumburk und Česká Lípa (Böhmisch Leipa) fertiggestellt. Verstärkt wurde an einer Anbindung an die sächsische Eisenbahn gearbeitet. Die verbesserte Infrastruktur beschleunigte die industrielle Entwicklung.
Die meisten Bewohner waren bereits in der frühen Neuzeit kulturell sowie konfessionell an die evangelische Kirche gebunden. Vor dem Dreißigjährigen Krieg glichen die Textilherstellung und der Handel die schlechte Bodenqualität und die damit zusammenhängende Gefahr einer Hungersnot aus. Das war die erste Phase wirtschaftlicher Konjunktur. Nach der Verneuerten Landesordnung im Jahre 1627, die den Protestanten vorschrieb, zum katholischen Glauben zu konvertieren oder das Land zu verlassen, entschied sich der Großteil der ortsansässigen ins benachbarte Sachsen zu gehen. Ökonomischen Auftrieb für die Region brachte der bedrohliche Österreichische Erbfolgekrieg und 1742 der Verlust Schlesiens als größten wirtschaftlichen Konkurrenten der Monarchie. Den gestiegenen Bedarf an Textilprodukten mussten die nordböhmischen Handwerker ausgleichen, die durch eine Reihe an Handels- und Fabrikprivilegien der aufgeklärten Monarchen Maria Theresa und Josef II. unterstützt wurden.
Seit dem 9. April 1849 gehören die angrenzenden Dörfer Neuwarnsdorf, Floriansdorf, Karlsdorf, Altfranzenthal, Neufranzenthal und Altwarnsdorf zur Gemeinde Warnsdorf mit 9600 Einwohnern. Die industrielle Entwicklung wurde durch den Krieg zwischen Österreich und Preußen im Jahre 1866 kurz unterbrochen, da sich das Heer oft in der Stadt aufhielt und Lebensmittel sowie Futter beschlagnahmte. Als bedeutende Textilfabrik ist die von Anton Fröhlich gegründete, auf die Herstellung von Samt spezialisierte, Firma hervorzuheben. Eine wichtige Rolle spielte der Fabrikant Andreas Hanisch, der sich auf Baumwoll- und Wollstoff sowie Halbseide spezialisierte. Der Wirtschaftszweig wurde stärker und mit ihm stieg auch die Anzahl der Bewohner verschiedener Konfession.
 Johann Gruss,
Johann Gruss,
Požár Varnsdorfu, 1829Die konfessionelle Vielfalt der Stadt zeigt sich in der Anzahl der Kirchen. In unserer Aufzählung fehlt die Kirche in Studánka (Schönborn), das erst 1980 eingemeindet wurde. Die zweite Hälfte des 19. und der Anfang des 20. Jahrhunderts waren für den Schluckenauer Zipfel und auch für Varnsdorf sehr lebendige Jahre der Kirchengeschichte. Den Spitznamen „Schwarze Ecke“, der von der typischen Farbe der Talare abgeleitet wurde, bekam diese Region nicht zufällig. Ein bedeutendes Ereignis stellte das sogenannte Philippsdorfer Wunder in der Nacht zum 13. Januar 1866 im nahegelegenen Filipov (Philippsdorf) dar. Damals wurde die Weberin Magdalena Kade von ihrer langwierigen und schweren Krankheit geheilt, als ihr die Mutter Gottes erschien. An der Stelle deren Erscheinung wurde in den Jahren 1873 bis 1885 die Kirche der Hilfreichen Jungfrau Maria erbaut, die zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte nördlich der Alpen wurde. Der Ansturm der Pilger ließ auch nach Ende der Monarchie nicht nach und dauert bis heute an. Zur gleichen Zeit wurde auch die katholische Kirche in Studánka (Schönborn) gebaut, da man sich erhoffte sie könnte zur Zwischenstation auf dem Weg nach Filipov werden.
Die wachsende Anzahl der katholischen Bewohner Varnsdorfs war gleichzeitig eine der Ursachen für den Bau der neuen Kirche des Heiligen Karl Borromäus im ehemaligen Karlsdorf. Heute ist sie eher unter dem Namen „Kirche ohne Turm“ bekannt.
In der Stadt bilden zwei Kirchen anderer Konfessionen das Gegengewicht zu den katholischen: die Evangelische Friedenskirche und eine altkatholische Kirche. Die Liberalen unter den Varnsdorfer Katholiken waren nicht begeistert von den Ergebnissen des ersten Vatikanischen Konzils des Papstes, das in den Jahren 1869 bis 1870 erhoben wurde. Die Gläubigen schlossen sich im Geiste der Los-von-Rom-Bewegung neu entstehenden Kirchen an, die Halt in der frühchristlichen Lehre suchten. Die Stadt Varnsdorf wurde bis zum Ende der Monarchie zum bedeutendsten Zentrum dieser Kirche. Die Anzahl der Protestanten war ebenso hoch und sie wollten ihr eigenes Gotteshaus haben. So wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts innerhalb eines Jahres eine neue Kirche für diese Konfession gebaut.
Das Wahrzeichen der Stadt blieb die katholische Barockkirche des Heiligen Petrus und Paulus. Im Jahre 1829 wurde sie durch einen Brand stark beschädigt, wurde jedoch bald rekonstruiert. Sie ist und bleibt die dominanteste unter den Stadtkirchen Varnsdorfs.
Am Bau der Gotteshäuser lässt sich nahezu der komplette kulturelle, geistliche und wirtschaftliche Aufschwung der Stadt von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs erkennen. Die Zeit des Gedeihens zwischen den beiden Weltkriegen war recht kurz und nach 1945 veränderte sich die Situation der Stadt bedeutend.
Der Gesellschaftswandel betraf auch die beschriebenen Gotteshäuser. Die neuen Bewohner hatten kaum Bezug zu den bestehenden kirchlichen Denkmälern und die politische Situation während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekam dem religiösen Leben ebenso nicht gerade gut. Die Objekte begannen unaufhaltsam zu verfallen. Heute stehen alle erwähnten Gebäude unter Denkmalschutz und dank großer Bemühungen derer, denen das Kulturerbe der Tschechischen Republik nicht gleichgültig ist, gelingt es, den Zustand der Kirchen in Varnsdorf zu verbessern.